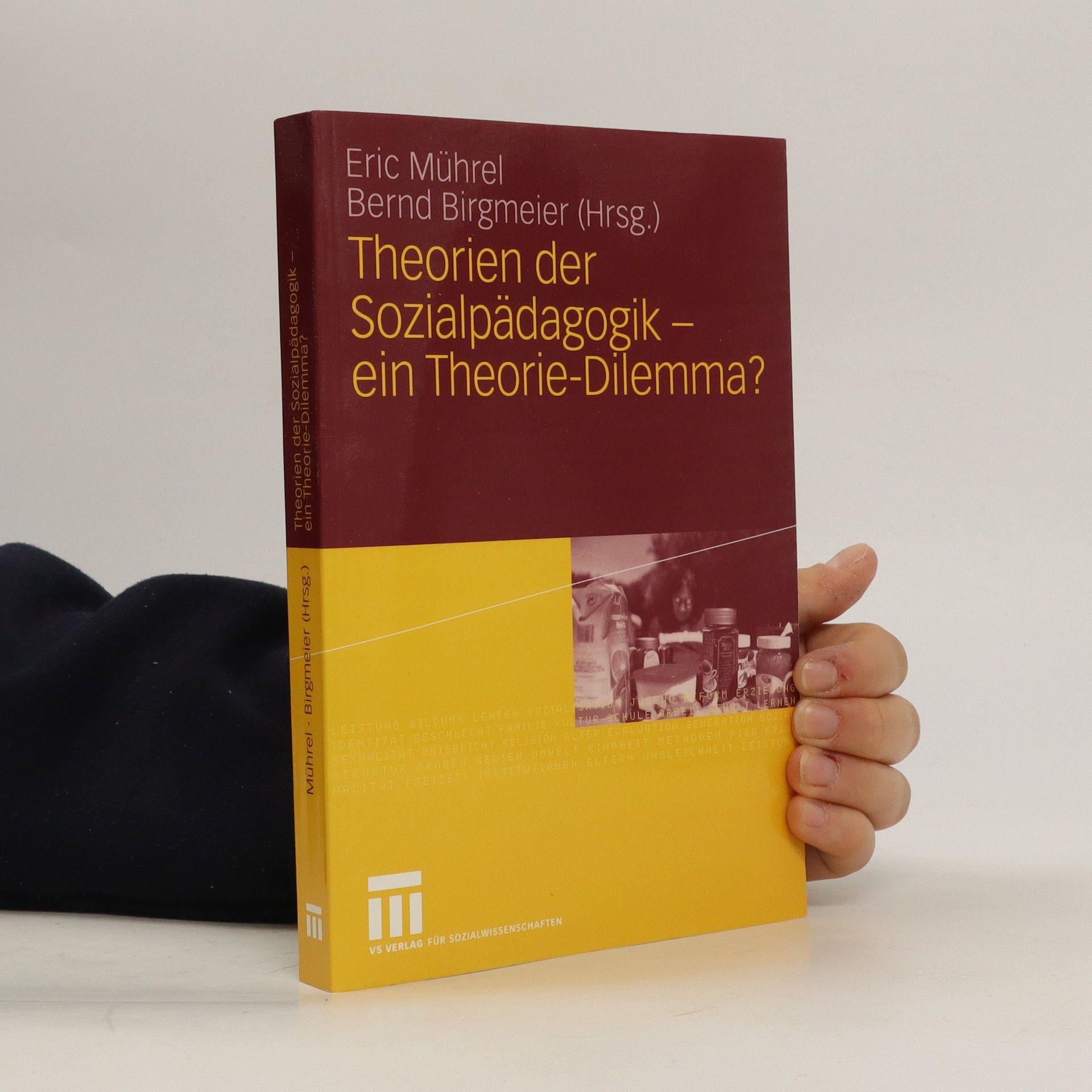Theorien der Sozialpädagogik - ein Theorie-Dilemma?
- 336pages
- 12 heures de lecture
Im Hinblick auf die diffuse Diskussion um die wissenschaftlichen und theoretischen Kerngedanken der Sozialpädagogik hat Hans-Ludwig Schmidt in seiner Dissertation versucht, verschiedene sozialpädagogische Entwürfe und Konzepte systematisch zu ordnen. Dies führte 1981 zur Monographie, in der er die vorliegenden theoretischen Ansätze kritisch analysierte und die Konturen eines handlungstheoretischen Neuansatzes skizzierte, der sich auf den einzelnen Menschen und dessen existenzielle Fragen konzentriert. Sein Ziel war es, das „Theorie-Dilemma“ der damaligen Sozialpädagogik zu lösen und innovative Wege für eine theoriegestützte Sozialpädagogik zu entwickeln. Ob dieses Dilemma heute als gelöst gelten kann, bleibt angesichts der jüngsten Debatten und Publikationen zur Wissenschaftlichkeit der Sozialpädagogik unklar. Die habilitierten Schüler von Hans-Ludwig Schmidt, die 2006 und 2007 ihre Abschlüsse erlangten, haben die Fragen nach den Theorien der Sozialpädagogik neu aufgerollt und nach aktuellen Antworten auf das sozialpädagogische „Theorie-Dilemma“ gesucht. Schmidt hat seit 1994 den Lehrstuhl für Sozialpädagogik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt inne und hat damit einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung des Fachs.