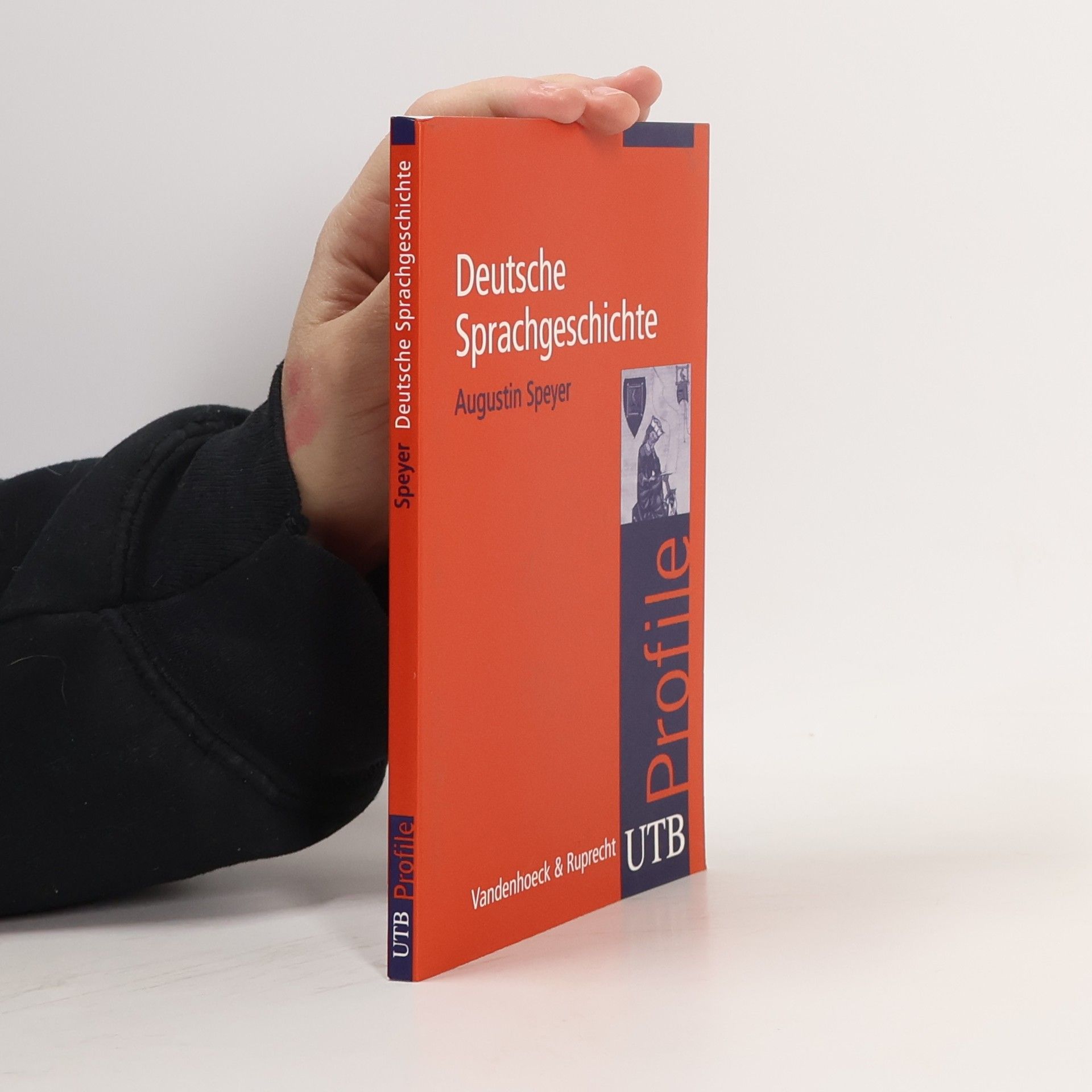Deutsche Sprachwissenschaft
Eine Einführung
Alle Kerngebiete der deutschen Sprachwissenschaft werden in diesem Studienbuch konzentriert und einprägsam erklä Textlinguistik, Pragmatik, Syntax, Wortbildung, Flexionsmorphologie, Semantik und Phonologie. Hinzu kommen Kapitel zu wichtigen Themen wie Erstspracherwerb, Sprachverarbeitung und Sprachwandel.Von zwei Experten der universitären Lehre verfasst und in der Praxis erprobt, liefert dieses klar strukturierte Grundlagenbuch genau das, was Studierende im Grundstudium der Germanistik oder Linguistik brauchen. Didaktisch geschickt ausgewählte Beispiele und Abbildungen veranschaulichen den komplexen Stoff. Wertvolle Literaturhinweise und ein Sachregister machen den Band auch als Nachschlagewerk nutzbar. ›Reclams Studienbuch Germanistik‹ bietet Fachwissen für das germanistische Grundstudium und darüber - Klar strukturiert - Verständlich formuliert - Praxisnah auf den Punkt gebracht E-Book mit Seitenzählung der gedrucketn Buch und E-Book können parallel benutzt werden.