Der Kolumbianer Nicolás Gómez Dávila (1913-1994) bezeichnete sich selbst als »Reaktionär«. Sein Denken ist ein Gegenentwurf zur Neuzeit und zur Aufklärung. Gómez Dávila stellt alles auf den Prüfstand, was manchem Zeitgenossen lieb und teuer geworden ist. Zweifellos gehört er zu den bedeutenden politischen Theologen des 20. Jahrhunderts. Daß sein Werk lange Zeit nur einem kleinen Kreis zugänglich gewesen ist, liegt vor allem daran, daß Gómez Dávila sich nie besonders um dessen Verbreitung gekümmert hat. In den letzten Jahren erleben seine Bücher und Aphorismen aber immer größere Beachtung. Das 2003 erstmals erschienene Buch von Till Kinzel ist die bis heute einzige deutschsprachige Monographie über den lateinamerikanischen Denker. Nun legt der Autor eine stark erweiterte Auflage seines Buches vor, mit der er alle Zusammenhänge des Denkens von Gómez Dávila beleuchtet. »Lesen heißt einen Stoß erhalten, einen Schlag spüren, auf ein Hindernis treffen«, so Gómez Dávila in seinem Werk »Notas«. Wer die Gedankenwelt des großen Philosophen begreifen möchte, kommt an dieser Monographie nicht vorbei!
Till Kinzel Livres
30 octobre 1968
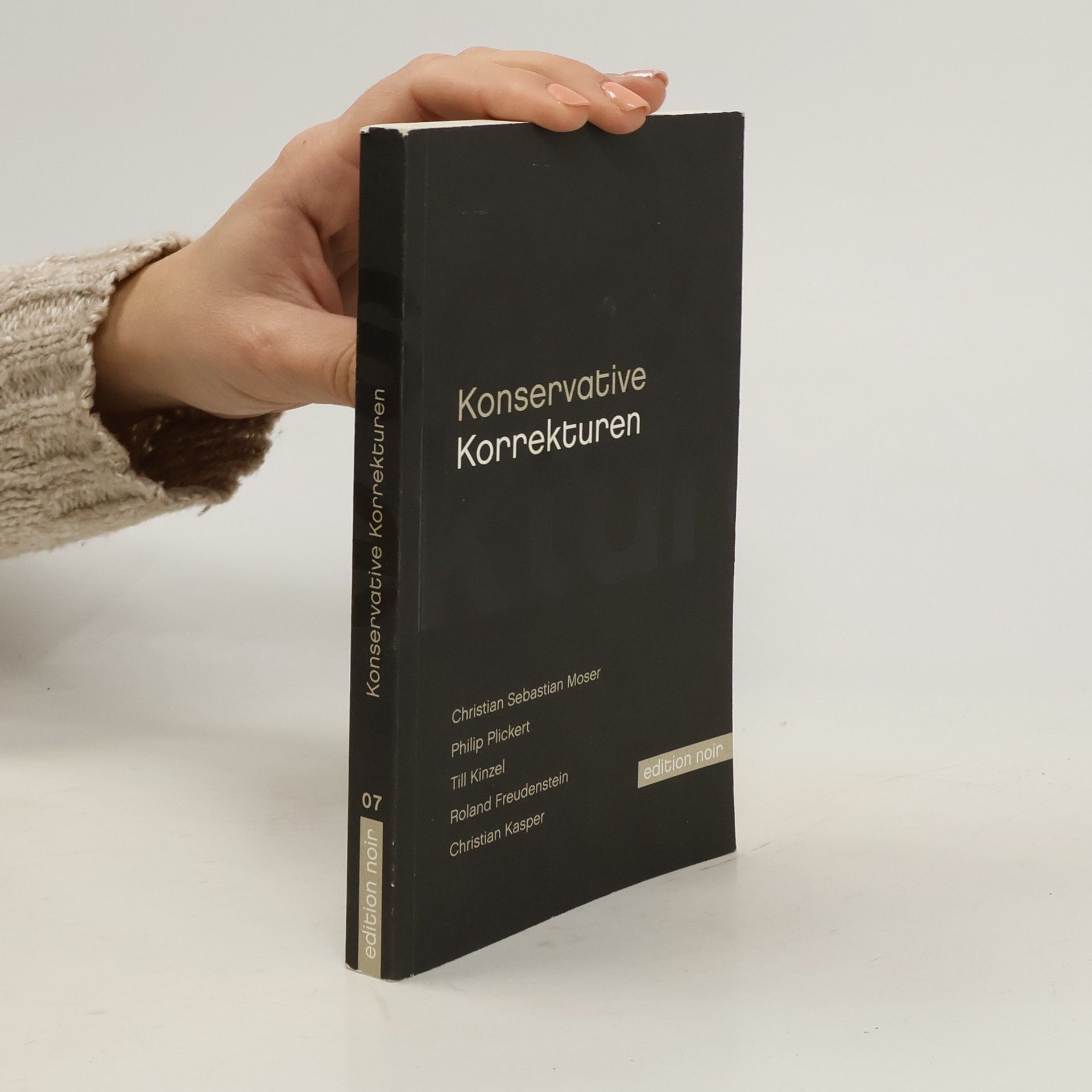
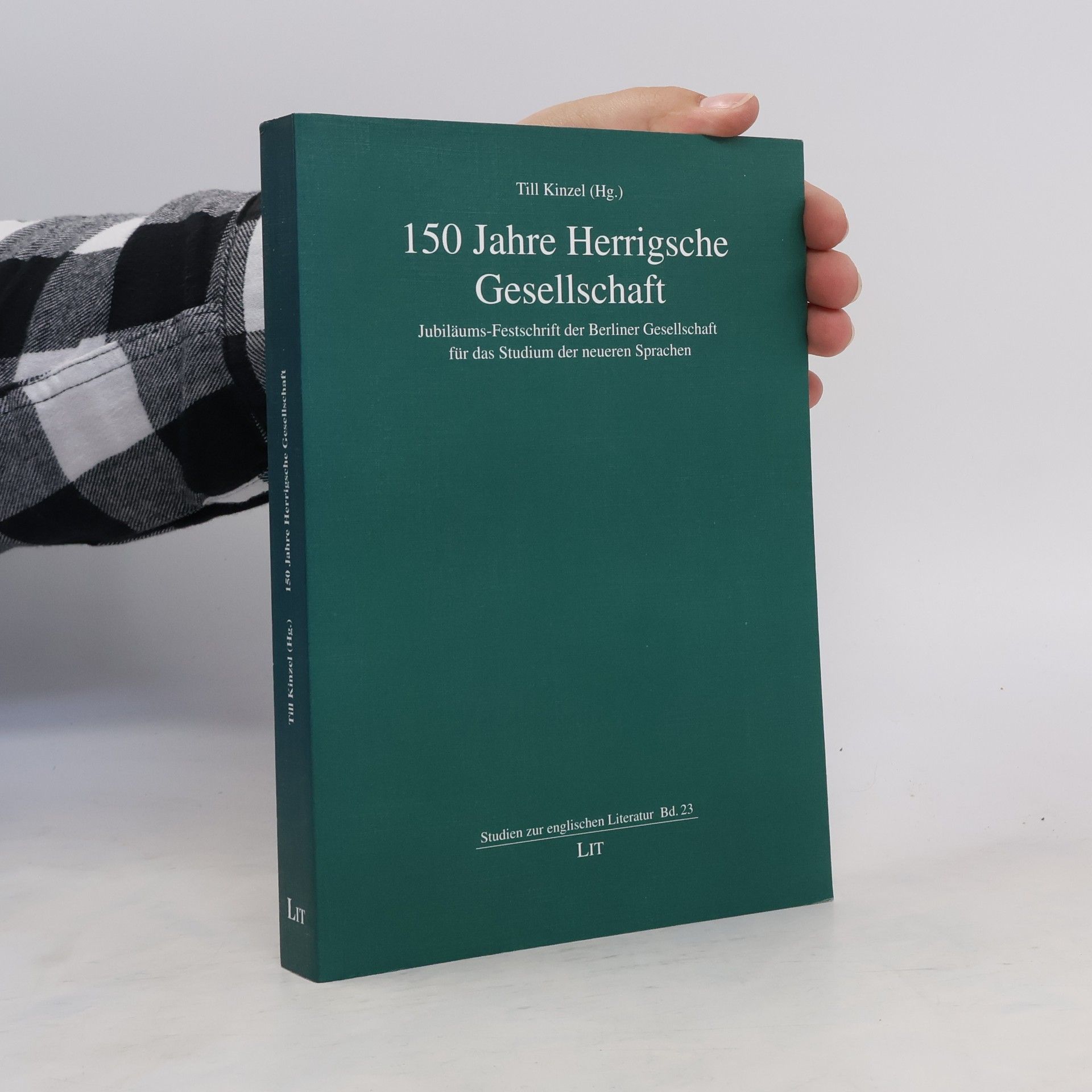

150 Jahre Herrigsche Gesellschaft
- 324pages
- 12 heures de lecture
Die Berliner Gesellschaft für das Studium der neueren Sprachen (Herrigsche Gesellschaft) ist die älteste noch bestehende neuphilologische Gesellschaft Deutschlands. Dieses faszinierende Kapitel der Wissenschaftsgeschichte wird hier detailliert vorgestellt, ergänzt durch Aufsätze u. a. aus Anglistik, Germanistik, Romanistik und Fachdidaktik. Mit Beiträgen von Jürgen Bartel, Eoin Bourke, Winfried Engler, Hans-Dieter Gelfert, Christa Jansohn, Fred Kaplan, Till Kinzel, Tatjana Kuhn, Manfred Lentzen, Almuth Meissner, Dieter Mindt, Manfred Pfister, Ingo Pommerening, Manfred Scheler und Felicitas Tesch.