Die Publikation beleuchtet die prägenden Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft und des Zweiten Weltkriegs in der Grenzregion Basel von 1933 bis 1945. Zwölf Autorinnen und Autoren bieten in dreissig bebilderten Kurzbeiträgen Einblicke in persönliche Schicksale sowie geografische und moralische Grenzfälle. Die Themen reichen von der Beziehung der Basler Bevölkerung zu den nationalsozialistischen Ideologien bis hin zu aktuellen Diskussionen über den Umgang mit dieser belasteten Vergangenheit. Ein anregendes Werk für alle, die sich mit dieser historischen Epoche auseinandersetzen möchten.
Patrick Kury Livres
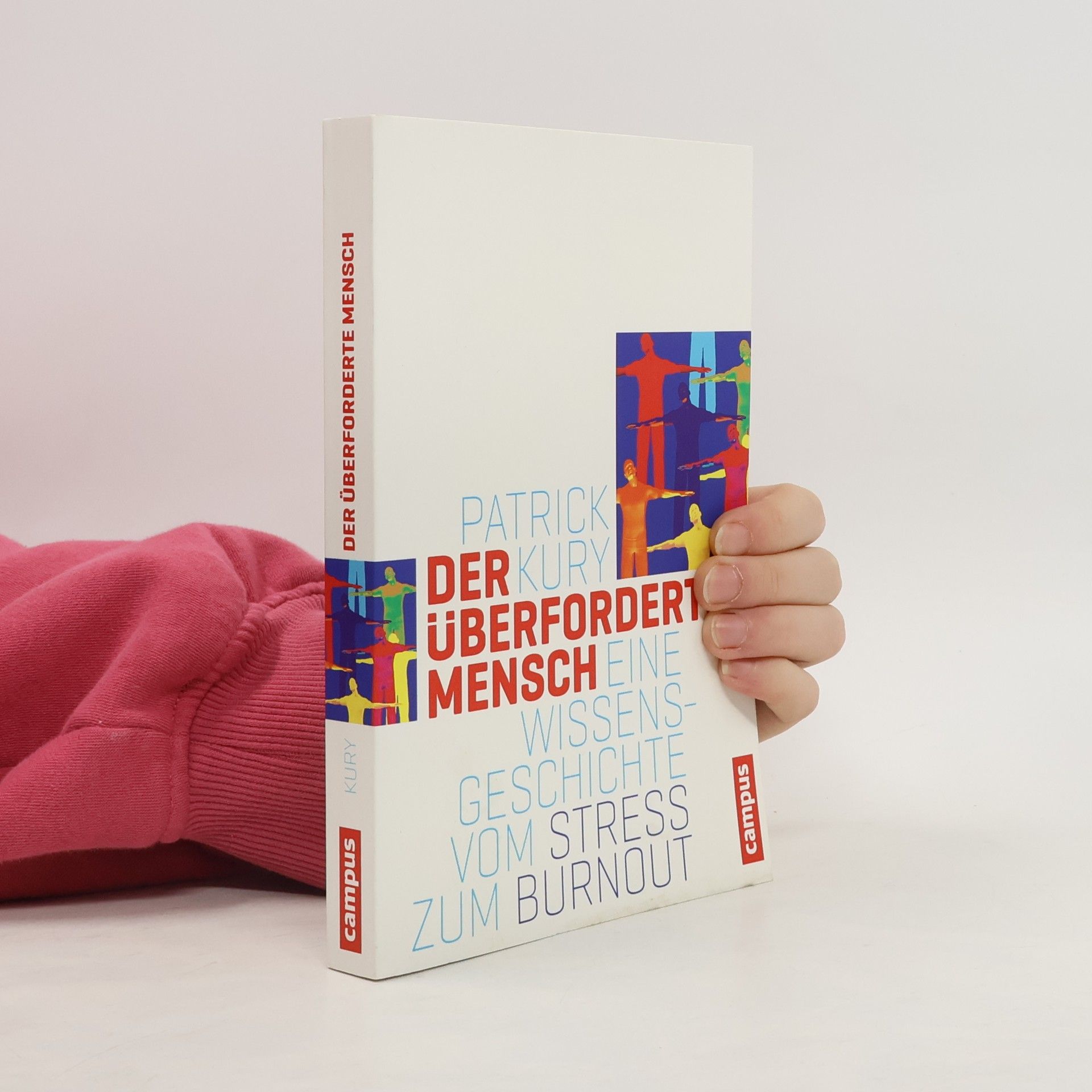


Band 6 der Stadt.Geschichte.Basel behandelt den Zeitraum von 1856 bis 1914, geprägt von schnellem Wandel und Wachstum durch die Eisenbahn. Diese bringt neue Möglichkeiten und verändert die Stadtstruktur. Basel entwickelt sich von einem protestantischen zu einer mehrkonfessionellen Stadt mit neuen politischen und wirtschaftlichen Strukturen.
Der überforderte Mensch
- 342pages
- 12 heures de lecture
Jeder kennt Stress und redet darüber, doch kaum jemand kennt seine Geschichte. Sie wird hier von Patrick Kury erstmals erzählt: von der Erforschung organischer Vorgänge in den 1930er Jahren über die psychosoziale Stressforschung in den USA und Skandinavien bis zur breiten Popularisierung des Stresskonzepts seit den 1970er-Jahren. Auch im deutschsprachigen Raum fand die Diskussion um den Stress in den letzten Jahrzehnten ein großes Medienecho. Die aktuelle Konjunktur des Burnouts ist der vorläufige Höhepunkt dieser Erfolgsgeschichte. Heute sind Stress und Burnout, so Patrick Kury, Allroundbegriffe, mit denen sich die Auswirkungen des modernen Lebens auf den Einzelnen kritisch beschreiben lassen: Beschleunigung und Flexibilisierung zwingen zu Selbstoptimierung und permanenter Anpassung - eine Aufgabe, die der Mensch offenbar nicht unbegrenzt und ohne negative Folgen erfüllen kann.