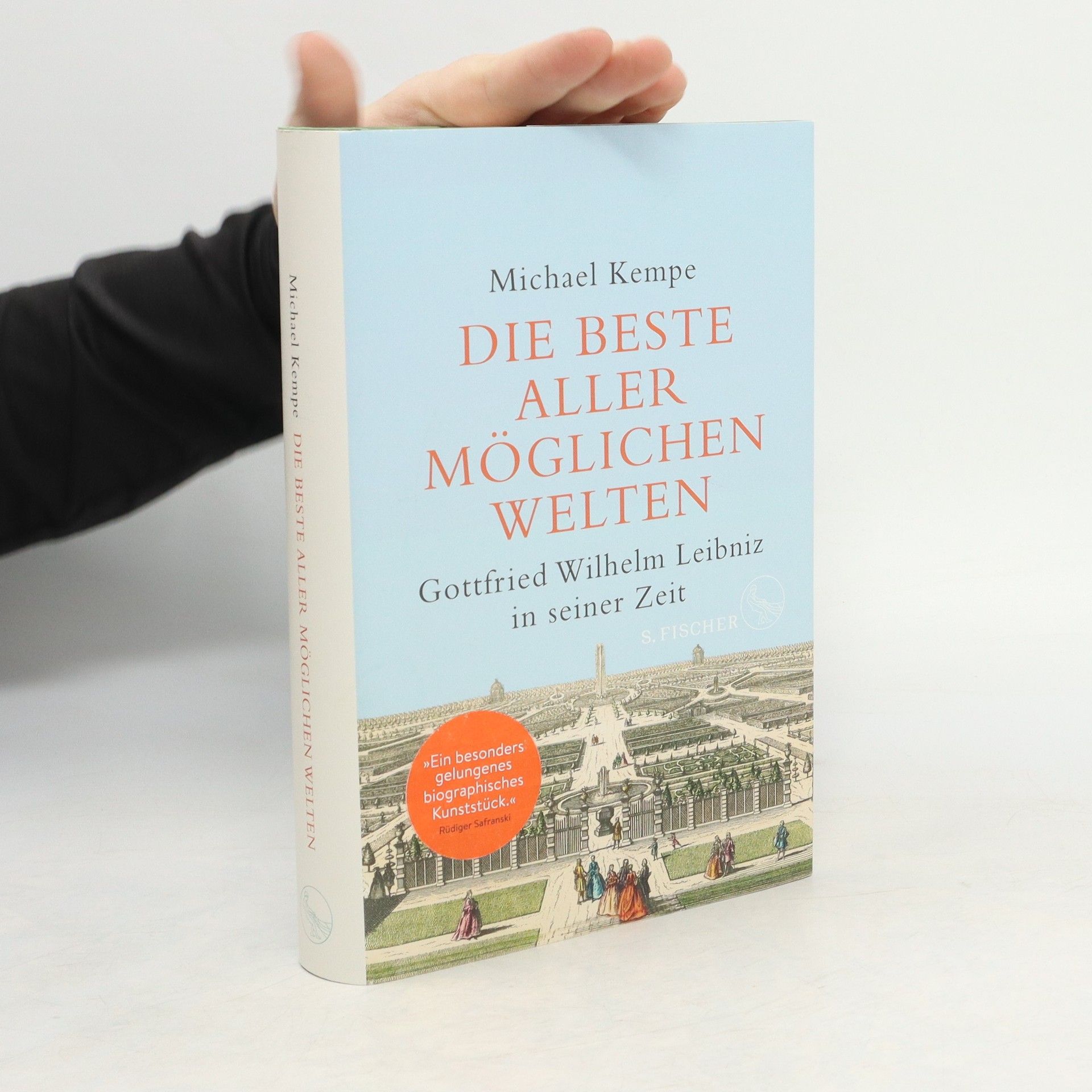Die beste aller möglichen Welten
- 352pages
- 13 heures de lecture
Michael Kempe hat eine zeitgemäße Biographie über Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) verfasst, die sieben ausgewählte Tage seines Lebens beleuchtet und dabei verschiedene Facetten seines komplexen Charakters zeigt. Leibniz war ein vielseitiges Talent – Philosoph, Mathematiker, Erfinder und Netzwerker. Durch die Erzählung von sieben Schlüsselmomenten in Leibniz’ Leben, die jeweils in unterschiedlichen Jahren stattfinden, erfahren wir viel über sein Denken und Arbeiten. Im Jahr 1675 in Paris bringt er das Integralzeichen »∫« zu Papier und löst damit einen bedeutenden Streit mit Isaac Newton aus. 1696 diskutiert er am Hof in Hannover mit der Kurfürstin Sophie über den Trost in der Philosophie. Sein bedeutendster Beitrag ist die Skizze einer Maschine, die mit den Zahlen 0 und 1 rechnet – der Grundstein für den modernen Computer. Leibniz’ philosophische Überlegungen, wie die in seiner »Theodizee«, zeigen, dass der Mensch die Welt durch sein Handeln verbessern muss. Kempe gelingt es, Leibniz als modernes Individuum darzustellen, das trotz seiner Zeitgenossenschaft im Barock und der frühen Aufklärung auch heute noch relevant ist. Mit seinem Optimismus ermutigt Leibniz dazu, nie die Hoffnung aufzugeben und aktiv nach Lösungen zu suchen. Diese Biographie bietet eine spannende und lebendige Reise in das Denken eines der größten deutschen Denker.