Kritische Theorie ist ein scharfsinniger Unsinn. Kritik – das bedeutet Prüfen, Unterscheiden, Urteilen. Theorie – das bedeutet eine Erkenntnisstruktur. Laut Kant bildet die Kritik darum eine »Propädeutik« zur Theorie. Wer beides zusammenschließt, verwickelt sich in einen Widerspruch. Von diesem scharfsinnigen Unsinn der kritischen Theorie handeln Gunnar Hindrichs’ Studien, die sich gegen die Meinung richten, kritische Theorie bilde ein sinnvolles Element im Gefüge der Wissenschaften. Ihr Geschäft, so Hindrichs, besteht vielmehr darin, die Krise des Sinns durchzuführen. In der vielfältigen Krise unserer Gegenwart aber wird ein Denken, das die Form der Krise in sich aufgenommen hat, auf neue Weise bedeutsam.
Gunnar Hindrichs Livres

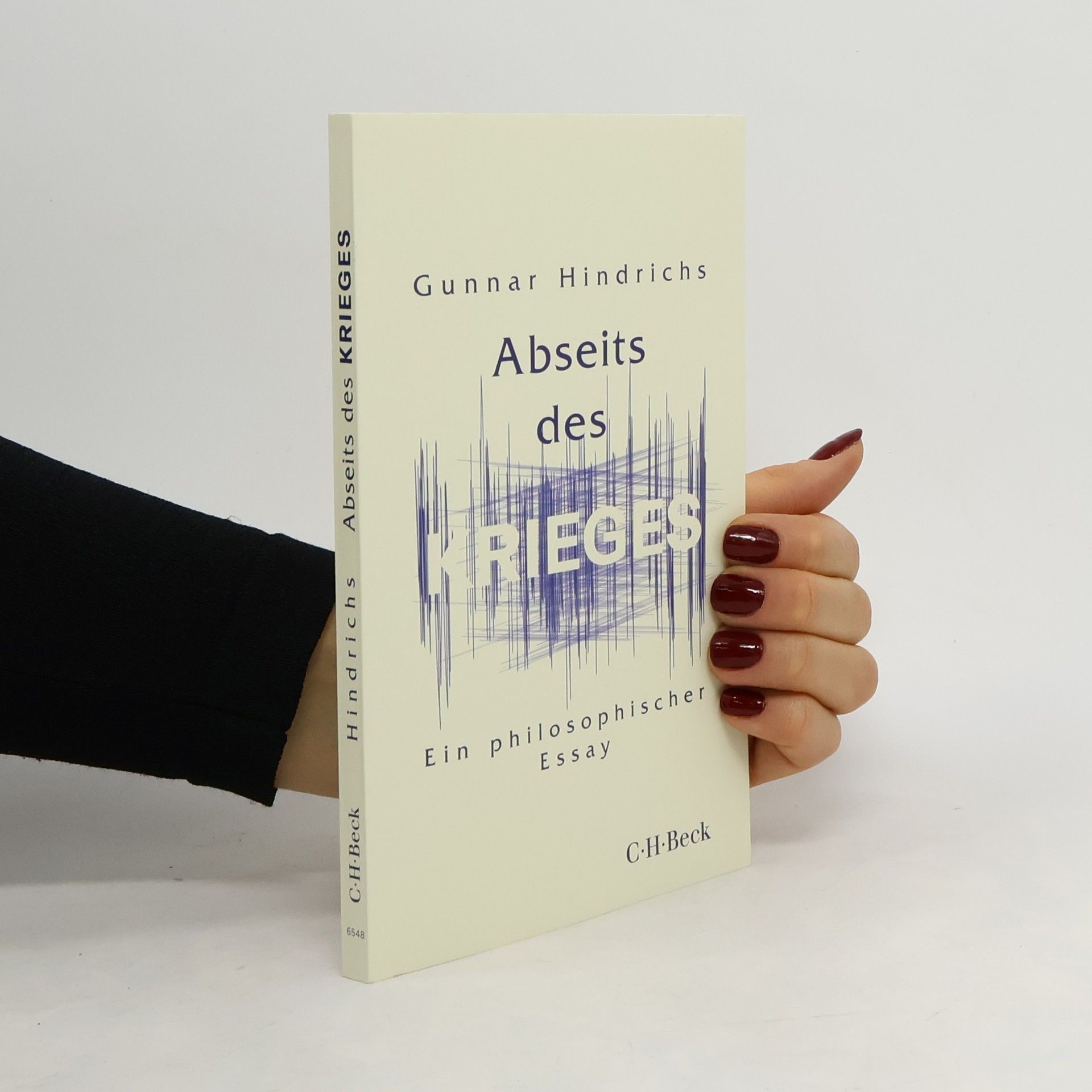

Abseits des Krieges
Ein philosophischer Essay
Das Absolute und das Subjekt
- 346pages
- 13 heures de lecture
Metaphysik und Nachmetaphysik sind zwei gegensätzliche Arten des philosophischen Denkens. Ihre jeweilige Eigenart und ihr Verhältnis zueinander lassen sich mit Hilfe zweier Größen begreifen: mit dem Begriff des Absoluten und mit dem Begriff des Subjekts. Das metaphysische Denken kreist um das Absolute, während die Nachmetaphysik das Subjekt zu ihrem Ausgang nimmt. Das Absolute und das Subjekt scheinen daher ebenfalls Gegensätze darzustellen. Hiergegen lautet der Grundgedanke dieses Buches, dass eine tragfähige Philosophie der Subjektivität nicht ohne Arbeit am Begriff des Absoluten auskommt. Ihn sucht es daher zunächst in Auseinandersetzung mit der Tradition des ontologischen Argumentes freizulegen, um ihn dann für die Problematik des Subjekts nutzbar zu machen. An seinem Ende steht die Verankerung des Subjekts in einem Unbedingten, das sich im Zuge analogen Denkens begreifen lässt. Diese spekulative Überlegung so klar wie möglich darzustellen, ist das Anliegen des Buches.